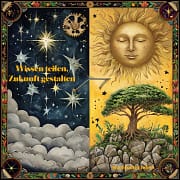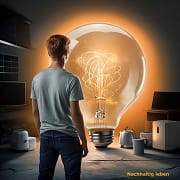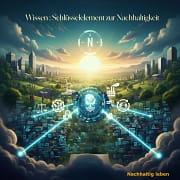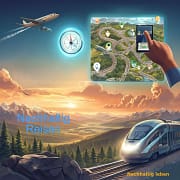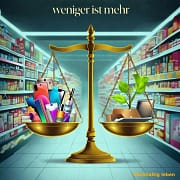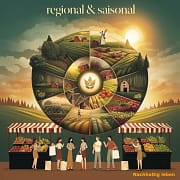Müll vermeiden als Turbo für die Kreislaufwirtschaft im Haushalt
Der wichtigste Schritt zur Kreislaufwirtschaft im Haushalt
Durch nichts entsteht in unserem Haushalt so viel Müll wie durch das Einkaufen, oft noch verstärkt dadurch, dass wir mehr kaufen, als wir eigentlich brauchen. Doch die gute Nachricht ist, dass du genau hier am einfachsten ansetzen kannst, um die Kreislaufwirtschaft im Haushalt aktiv zu leben.
Müll vermeiden beginnt bereits vor der Haustür und ist die effizienteste Methode, um Ressourcen zu schonen.
Geschätzte Lesedauer: 5 Minuten
Einkaufen: Das A und O der Abfallvermeidung
Das Bewusstsein, Müll zu vermeiden, startet im Supermarkt. Wähle Produkte mit wenig Verpackung oder in wiederverwendbaren Behältern, um die Menge an Einwegverpackungen drastisch zu reduzieren.
Verpackungsmüll vermeiden leicht gemacht:
- Nachfüllen statt Neukaufen: Für Seife, Reinigungsmittel und viele andere Produkte gibt es Nachfüllpacks. Viele Drogeriemärkte bieten bereits Zapfstationen für Pflege- und Reinigungsprodukte an – bring einfach deine eigene Verpackung mit!
- Auf Unverpacktes umsteigen: Kaufe Obst, Gemüse, Brot und Semmeln (Brötchen) unverpackt. Viele Supermärkte bieten wiederverwendbare Gemüsenetze an, oder du nutzt einfach deinen eigenen Einkaufskorb. Auch an Frischetheken kannst du dir Wurst und Käse in deine eigenen, wiederverwendbaren Verpackungen legen lassen.
- Großpackungen nutzen: Kaufe, wenn möglich, Großpackungen (z.B. bei Spülmaschinen-Tabs), um den Verpackungsmüll pro Einheit zu reduzieren. Als schöner Nebeneffekt sparst du dabei auch noch Geld.
Papier sparen: Ein Klassiker der Kreislaufwirtschaft
Papier zu sparen, gehört zur üblichen Praxis eines nachhaltigen Haushalts. Nichtvermeidbare Papierabfälle sollten dabei vom Restmüll getrennt und über den Altpapiercontainer dem Recycling zugeführt werden, um den Kreislauf zu schließen.
- Stoff statt Zellstoff: Tausche Papierservietten gegen solche aus Leinen oder Baumwolle. Auch Taschentücher aus Zellstoff gegen waschbare Stofftaschentücher zu tauschen, ist ein konsequenter Schritt (daran muss ich weiter arbeiten).
- Küchenrollen-Alternativen: Tausche Küchenrollen gegen saugfähige und waschbare Stofftücher aus. Wenn du nicht ganz darauf verzichten kannst (weil sie halt so wahnsinnig praktisch sind), achte auf die Kennzeichnung „kompostierbar“ und entsprechende glaubwürdige Zertifizierungen und gib sie dann in deinen Kompost oder Biomüll.
- Digitalisierung im eigenen Haushalt: Digitalisiere deine Dokumente und verzichte auf die übliche Zettelwirtschaft. Lade Tickets, Karten und Reiseführer auf dein Mobiltelefon. Installiere eBook-Reader-Apps und lese bevorzugt digital. Das bedeutet nicht, dass du deine Lieblingsschmöker nicht in Buchform geniessen darfst! Es geht um die alltägliche Lektüre.
- Bewusster Drucken: Wenn du wirklich etwas ausdrucken musst, verwende Recyclingpapier, drucke doppelseitig und in Schwarzweiß.
- Backpapier-Alternativen: Verwende Backpapier mehrfach, sie sind meist einfach zu reinigen. Alternativ kannst du Dauerbackmatten aus Silikon oder einen Brotbackstein aus natürlichem Tonmaterial nutzen.
Nachhaltige Verpackungen: Leben im Kreislauf
Verpackungen schützen Produkte, doch sie sind auch eine enorme Müllquelle. Müll vermeiden bedeutet hier auch, nur Verpackungen zu verwenden, die leicht in die Kreislaufwirtschaft im Haushalt zurückgeführt werden können. Grundsätzlich ist jede wiederverwendbare Verpackung nachhaltiger als eine Einmalverpackung, selbst wenn sie aus recyceltem Plastik ist.
Wenn Verpackungen notwendig sind, sollten sie vorzugsweise aus nachhaltigen Materialien bestehen:
- Pappe und Papier: Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und gut recycelbar.
- Glas und Metall: Robust, wiederverwendbar und exzellent recycelbar. Trinkflaschen und Edelstahldosen können oft ein Leben lang halten.
- Biokunststoffe: Werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aber gib acht! Sie sind nicht automatisch kompostierbar, informiere dich also genau über die Entsorgung.
Deine Küche: Vom Biomüll zum Dünger
Die Küche ist der Mittelpunkt unseres Haushalts und kann eine Müllfalle sein. Mit einfachen Tricks kannst du auch hier Müll vermeiden:
- Planung ist alles: Mache vor jedem Einkauf eine Liste und gehe diszipliniert danach einkaufen, um Konsumfallen zu vermeiden und Lebensmitteleinkäufe zu rationalisieren.
- Reste verwerten: Lerne, wie du deine Lebensmittel länger frisch hältst und Reste kreativ verwertest. Das verhindert unnötigen Bio- und Verpackungsmüll. Erinnerst du dich noch an die meist leckeren „Resteessen“ in deiner Kindheit?
- Reinigungsmittel selbst herstellen: Stelle deine Reinigungsmittel selbst her, um Plastikverpackungen und scharfe Chemikalien zu vermeiden. Du findest im Internet dazu gute Anleitungen.
- Kompostieren: Verwerte deine Bioabfälle zu wertvollem Dünger für deine Pflanzen (z.B. Kaffeesatz) und schließe so den Nährstoffkreislauf.
Müll vermeiden ist der wirkungsvollste Hebel, um die Kreislaufwirtschaft im Haushalt zu etablieren. Jeder kleine Schritt zählt! Stell dir doch mal vor, eine Mehrheit in unserem Land würde nur die hier beschriebenen kleinen Tipps umsetzen!
Mein Tipp für den nächsten Schritt
Du möchtest wissen, wie du die Kreislaufwirtschaft im Haushalt mit einfachen Mitteln optimieren und Müll vermeiden kannst?
In meinem Buch „Nachhaltig leben – 77 praktische Tipps für deinen Alltag“ (ISBN 978-3-662-70530-8) findest du die komplette Anleitung und weitere konkrete Werkzeuge, um deinen Haushalt müllfrei(er) zu gestalten.
Nachhaltig leben im Alltag
Wenn du mehr zum Thema wissen willst, schau dich doch auf meiner Website um, oder lies einen der nachfolgend aufgeführten Beiträge.